Kommentar zu: Jens Jessen, Das Ende der Globalisierung
- Christiane Krieger-Boden

- 2. Juni 2022
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 28. Juli 2022
In: „DIE ZEIT“ N° 21, 19. Mai 2022
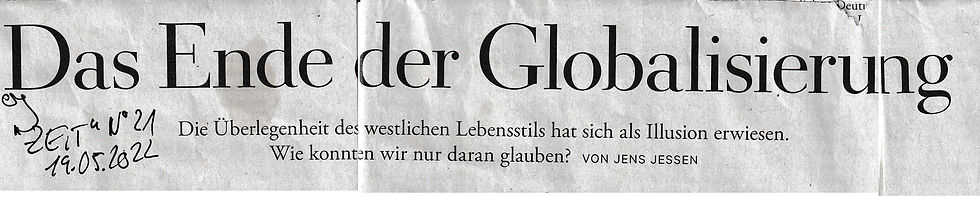
Dieser Artikel steht exemplarisch für eine weit verbreitete Globalisierungskritik – wie weit verbreitet, zeigen beispielsweise die durchweg zustimmenden, teils euphorischen Leserzuschriften, die zwei Wochen später in der ZEIT veröffentlicht worden sind. Aber diese Haltung ist geprägt von einer Kombination aus Naivität, Kurzschlüssen und Ahnungslosigkeit. Daher: Widerspruch! – und man weiß kaum, wo beginnen. Fangen wir mal mit der Unter-Überschrift an.
„Die Überlegenheit des westlichen Lebensstils hat sich als Illusion erwiesen. Wie konnten wir nur daran glauben?“
Da fragt man sich doch, auf welchem Planet der Autor eigentlich gerade lebt? Worum kämpfen die Ukrainer gerade nochmal mit erbitterter Verzweiflung gegen die Russen? Weshalb wollen Finnen und Schweden plötzlich dringend in die NATO, scharen sich Europäer, Australier, Japaner, Koreaner usw. eng um die USA, sind sich die westlichen Länder nah und einig wie lange nicht? Illusionärer westlicher Lebensstil? Nein, überall dort, wo Menschen das Recht und die Möglichkeit, haben, frei und unbeeinflusst zu wählen, wählen sie den „westlichen Lebensstil“ und gehen dafür auf die Straße, lassen sich dafür verprügeln, einsperren und foltern, ob in Belarus, Venezuela, Hongkong, Iran, Kirgisistan, usw., usw. – er erscheint so populär wie lange nicht mehr.
„Der Westen, der [von Russland u.a.] als Wirtschaftspartner angenommen wurde, bildete sich ein, damit auch als kulturelles und politisches Vorbild etabliert worden zu sein. … Der westliche Fortschrittsgedanke verlangte es, und zu ihm gehörte, dass man sich den Fortschritt als unumkehrbar dachte, als eine unaufhaltsam zum Guten eilende Moderne, die am besten in einem weltweit ausgreifenden Kapitalismus aufgehoben war.“
Was richtig an diesem Absatz ist: die Formel „Wandel durch Handel“ ist in der Tat oft nicht so aufgegangen, wie man sich das im Westen vorgestellt hat – zumindest noch nicht. Handel mit autoritär und diktatorisch regierten Staaten hat nicht immer dazu geführt, dass diese westliche Werte annahmen. Fortschritte hat es durch Globalisierung trotzdem gegeben, vor allem hinsichtlich der Verringerung von Armut und Hunger, auch von Gewalt, selbst von Krieg. Autoren wie Hans Rosling und Sohn (Statistisches Forum „Gapminder“), Max Roser (Statistik-Plattform „Our World in Data“), Steven Pinker (Buch „Gewalt“) haben das eindrücklich gezeigt und belegen es immer wieder aufs Neue (auch wenn Pandemie und Ukraine-Krieg deprimierenderweise gegenwärtig Armut und Hunger wieder verschlimmern).
Armut und Hunger sind übrigens vor allem zurückgegangen wegen der von Jessen kritisierten globalisierungsbedingten
„Verlagerung der Arbeitsplätze: den Wegfall gut bezahlter und sozial abgesicherter Stellen in den westlichen Staaten und ihre Ersetzung durch miserabel entlohnte, humanitär katastrophale in den Entwicklungsländern - im »globalen Süden«, wie man heute euphemistisch sagt.“
Tja, aber ein schlechter Arbeitsplatz war für den »globalen Süden« immer noch besser als gar keiner, und nicht wenigen Ländern, zunächst Japan, dann den „vier kleinen Tigern“ Südkorea, Singapur, Taiwan und Hongkong, dann China und Indien, und im Gefolge auch weiteren asiatischen und manchen afrikanischen Ländern, ist es auf diesem Weg gelungen, allmählich eine wohlsituierte Mittelschicht heranzubilden und aufzubauen. Und solch wirtschaftlicher Fortschritt ist den Menschen zu gönnen, selbst wenn sich Hoffnungen auf Rechtsstaat, Menschenrechte, Demokratie und Umweltschutz nicht überall erfüllt haben. Die Lifestyle-Ansage „wir kaufen nur noch regional“ nimmt dagegen den ärmsten Ländern Entwicklungschancen.
Überhaupt, die westlichen Werte, Jessen tut so, als wären sie mit dem
„weltweit ausgreifenden Kapitalismus“
identisch. Widerspruch! Die westlichen Werte heißen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit, Demokratie mit freien Wahlen und breiter Wohlstand für alle. Was das mit Kapitalismus zu tun hat, und was „Kapitalismus“ überhaupt sein soll, habe ich – als Ökonomin – noch nie so recht verstanden.
Wenn mit „Kapitalismus“ Marktwirtschaft und freier Welthandel gemeint sein sollten, dann ist das etwas, wofür sich westliche Länder in der Tat einsetzen, aber nicht als Wert, sondern als Mittel, um Wirtschaft und Produktion dezentral und damit effizient zu organisieren.
Wenn mit „Kapitalismus“ die schrankenlose Herrschaft durch das Kapital, durch puren Reichtum und ungenierte Raffgier, gemeint ist, dann hat das eher nichts mit westlichen parlamentarischen Demokratien zu tun, sondern charakterisiert viel eher die Oligarchokratien russischen und teilweise auch lateinamerikanischen und afrikanischen Typs, die von einer kleptomanen Machtelite gelenkte Staatswirtschaft Chinas oder die Scheichdiktaturen Arabiens. In westlichen Ländern dagegen wird die Herrschaft des Kapitals mit vielen Stellschrauben eingeschränkt und reguliert, um Ungleichheit zu begegnen, um die von Jessen selbst erwähnten
„gut bezahlte[n] und sozial abgesicherte[n] Stellen“
durch einen umfassenden Sozialstaat zu gewährleisten, und um Macht zu kontrollieren und zu begrenzen, bis hin zur Zerschlagung von marktbeherrschenden Unternehmen und Monopolen. Natürlich funktioniert das nicht immer perfekt, wie nichts auf der Welt perfekt ist, aber das Bemühen darum und die Erfolge dabei sind Teil des „westlichen Lebensstils“ und begründen seine fortgesetzte Attraktivität.
„Selbst der gänzlich erfolglose Afghanistan-Einsatz war, wenn auch mit militärischen Mitteln geführt, von der selbstgewissen Hoffnung inspiriert, dass der Kontakt mit den überlegenen Konsumprodukten der kapitalistischen Moderne die Bevölkerung dazu bringen würde, so etwas auch haben zu wollen, einschließlich der parlamentarischen Demokratie und der Gewissensfreiheit, die man untrennbar mit Red Bull und Coca-Cola zusammendachte: gewissermaßen als Geist in der Flasche.“
Auch hier Widerspruch! von vorne bis hinten. Der Afghanistan-Einsatz, so traurig und blamabel er auch ausgegangen ist, war nicht „gänzlich erfolglos", er hat einer Generation von jungen Afghanen Bildung ermöglicht, die sie sonst nicht erhalten hätten, und die ihnen, gerade auch den Frauen, ein Selbstbewusstsein gegeben hat, das sie trotz des gegenwärtigen Roll-backs nicht vergessen werden und das die Situation dauerhaft verändert hat. Und gewiss war es niemals das Ziel, den Afghanen vor allem Red Bull und Coca-Cola nahe zu bringen, und niemand glaubte, dass Konsumgüter untrennbar mit Gewissensfreiheit und parlamentarischer Demokratie verbunden sind.
„Putins Bild eines dekadenten und wertevergessenen Westens ist keineswegs so wahnhaft, wie man es hinstellen möchte. Er konnte genauso wie die chinesische Regierung denken, wer nur am Geld und am eigenen wirtschaftlichen Wohl und Wehe interessiert sei, werde brutaler Machtpolitik nichts entgegensetzen. Der Westen hat ja auch Hongkongs Verlust seiner Freiheiten mit wenig mehr als einem bedauernden Achselzucken quittiert, um den chinesischen Mark nicht zu verlieren.“
Aber es hat sich ja gerade gezeigt, wie irrig Putins Bild vom Westen war. Nicht der Westen hat sich als wertevergessen erwiesen, sondern Putins Russland. Selbst wenn man Putins Vorgehen an seinem eigenen Wertekanon einer gewissermaßen heiligen russischen Nation misst – wie verträgt sich damit der brutale blutige Überfall auf das von den Russen selbst so deklarierte „Bruder“volk? Und dass der Westen Hongkong nicht stärker unterstützt hat – seltsamer Vorwurf von jemandem, der den Afghanistan-Einsatz für völlig unnütz hält! –, das lag doch nicht daran, dass man um den chinesischen Markt fürchtete. Man hat ja auch nicht eingegriffen, um die syrische Bevölkerung vor den Brutalitäten Assads und seines Waffenbruders Putin zu schützen, obwohl dort keine nennenswerten Märkte auf dem Spiel standen. Bitter, aber wahr: es ist schlicht unmöglich, alles Elend dieser Welt mit gleicher Aufmerksamkeit und Intensität zu bekämpfen. Mit der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China war eigentlich klar, dass Hongkongs Schicksal nur noch vom Wohlwollen Chinas abhing.
„… aus der guten, nämlich für emanzipatorisch gehaltenen Verflechtung ist eine schlechte Abhängigkeit des Westens von Schurkenstaaten geworden.“
„Man hat ja auch zur Zeit Pinochets nicht aufgehört, chilenisches Kupfer zu kaufen. Man hat die Blutdiamanten aus afrikanischen Sklavenbergwerken gerne um den Hals getragen“
Sicher gibt es extrem problematische Produktionsbedingungen, sicher ist es schwierig, von „Schurkenstaaten“ abhängig zu sein, und sicher muss man im Einzelfall genau abwägen, welche Produkte man wo kauft oder auch nicht kauft. Helfen tut mehr Diversifizierung bei Lieferanten und Abnehmern, was allerdings nicht zwangsläufig zu weniger, sondern auch zu mehr internationalem Handel führen kann.
Klar ist aber auch: Abhängigkeiten werden sich niemals vollständig beseitigen lassen, da man manche Vorprodukte einfach braucht und nicht im eigenen Land, vielleicht auch nicht in den „guten“ Partnerländern gewinnen kann. Beispielsweise könnten durch neue Energiekonzepte neue Abhängigkeiten von sonnenreichen Ländern, etwa im politisch nicht immer zuverlässigen Maghreb, entstehen, wenn dort mit Sonnenkollektoren Wasserstoff für den Norden produziert wird. Für den einzelnen Endkäufer ist sowieso schwer zu durchblicken, welche Vorprodukte unter welchen Produktionsbedingungen auf einen der vielen Stufen der Lieferkette in das Endprodukt eingegangen sind. Und dann ist der Unterschied zwischen „gut“ und „schlecht“ nicht antagonistisch, sondern mit vielen graduellen Abstufungen. Etwa, wenn man an afrikanische Länder denkt: moralisch sauber und unbedenklich ist wohl keines der Länder (außer vielleicht Botsuana), aber es gibt Unterschiede. Soll man diejenigen Länder, die besonders korrupt, diktatorisch und aggressiv sind, aus dem Handel und der internationalen Arbeitsteilung ausschließen und damit die ohnehin gebeutelte Bevölkerung ohne jede Aussicht auf Verbesserung wenigstens ihres wirtschaftlichen Schicksals lassen?
„Das heißt: Man kann die Welt auseinandertreiben – durch Moral. Oder man macht sich mit Schurken gemein – durch Globalisierung. Eines von beiden bleibt.“
Widerspruch! das ist zu simpel. Man wird Handel/Globalisierung nicht ohne Moral betreiben und sich nicht zu sehr in einseitige Abhängigkeiten begeben können. Aber man wird in der einen, wechselseitig abhängigen Welt auch nicht ganz darauf verzichten können, mit den Schurken dieser Welt umzugehen, mit ihnen zu handeln und zu verhandeln. Auf die Balance kommt es an!



Kommentare